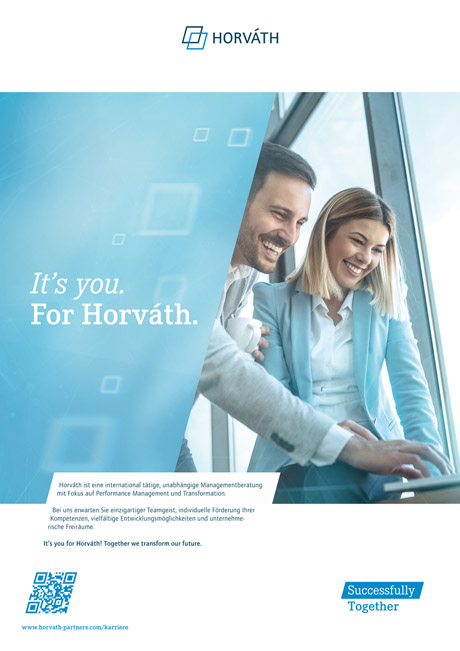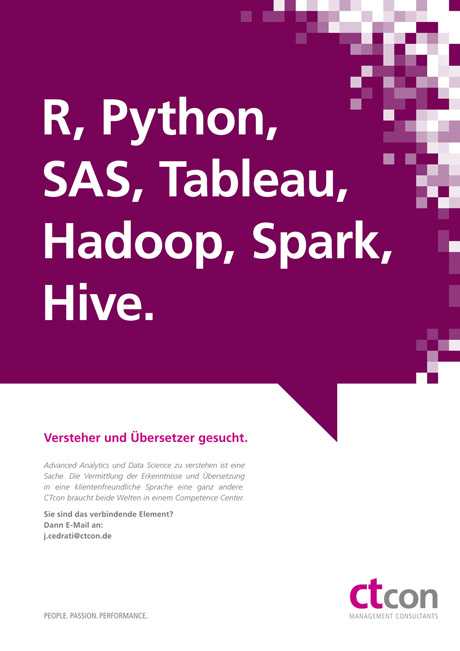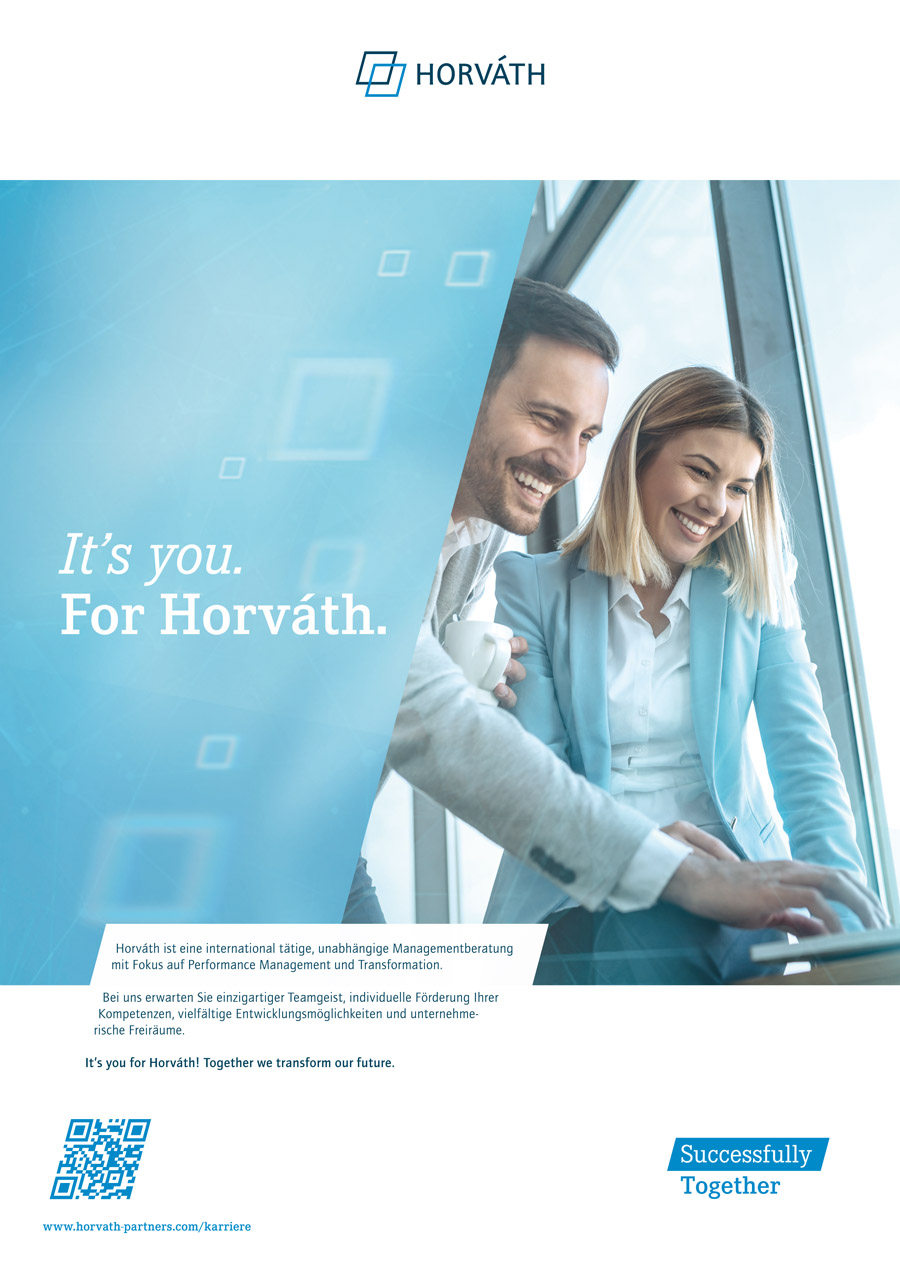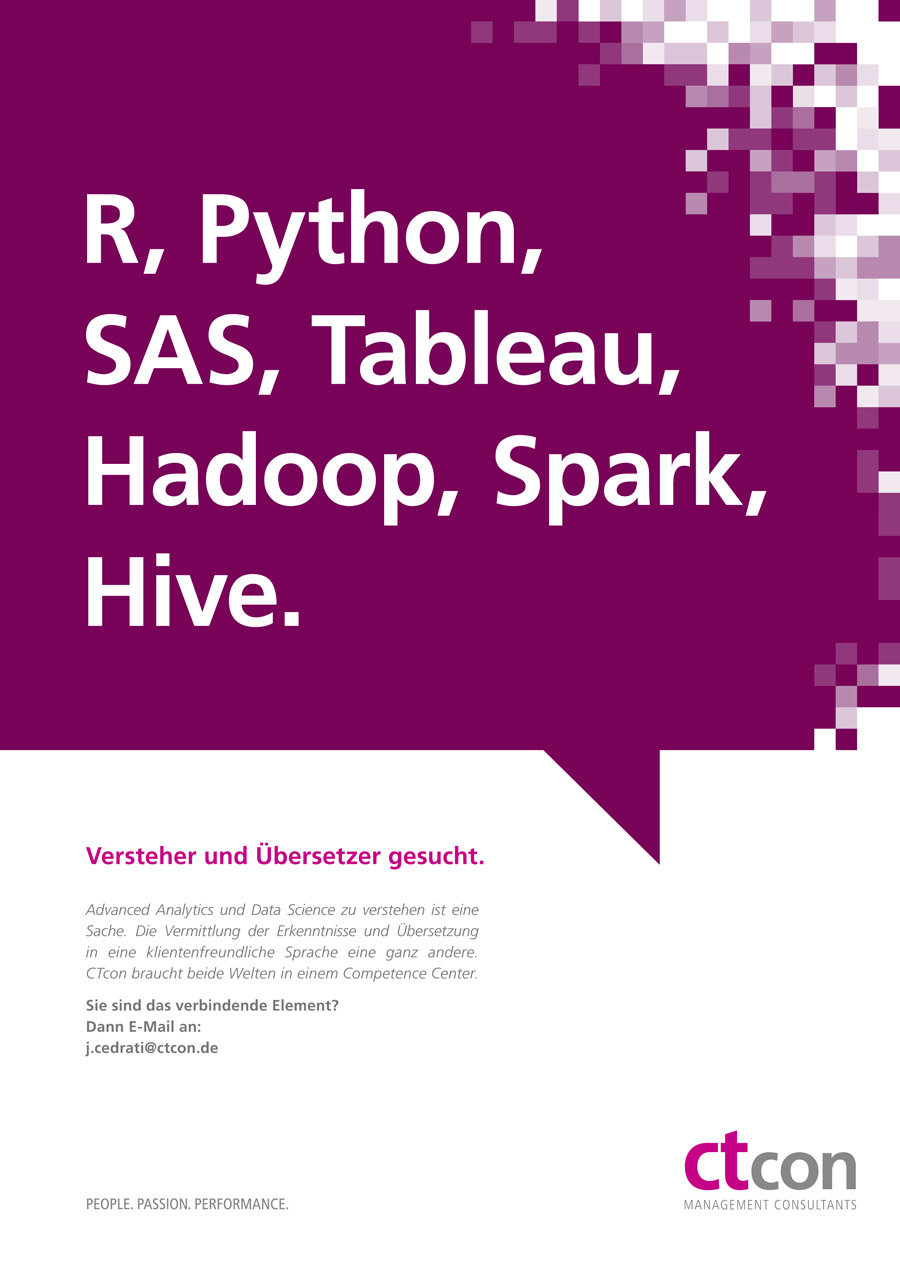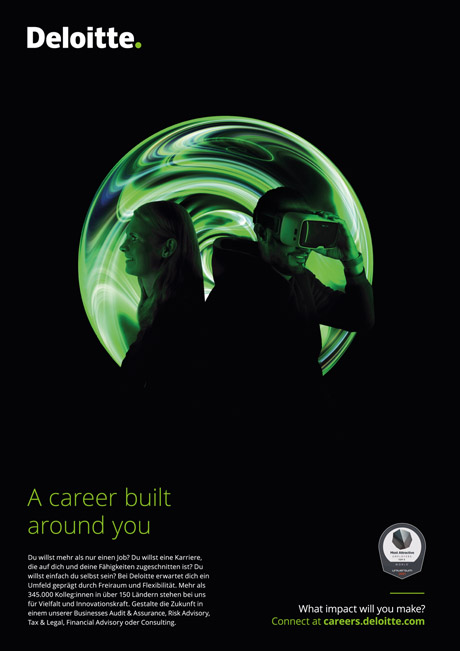Berufsreport Controlling
Vom Controlling
zur Unternehmenssteuerung
Ihr Berufsbild hat sich in den letzten Jahren gewandelt: Controller nehmen zunehmend auch strategische Aufgaben wahr. Das führt sie immer öfter bis an die Unternehmensspitze.
Als der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn im März Richard Lutz zum neuen Bahnchef ernannte, folgte er damit einem seit einigen Jahren zu beobachtenden Trend. Nämlich den bisherigen CFO zum CEO zu machen. Zuvor hatten bereits Unternehmen wie BASF, Siemens, die Deutsche Telekom und Bertelsmann ihren Finanzvorstand zum neuen Vorstandschef ernannt. Auch Allianz-Chef Oliver Bäte leitete das Finanzressort, bevor er 2015 die Nachfolge des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Diekmann antrat.
Dass Controller nicht nur Bilanzen lesen und komplexe Zahlenwerke durchschauen, sondern auch Konzerne mit zehntausenden Mitarbeitern steuern können, hat sich in der Wirtschaft offenbar herumgesprochen. Inzwischen wird jedes dritte Dax-Unternehmen von einem früheren Controller geleitet. Entsprechend groß ist deren Ansehen und Selbstbewusstsein. Laut Umfragen trauen sich 70 Prozent der Chief Financial Officers die Leitung ihres Unternehmens zu.
Horváth & Partners
Mehr als nur Controlling
Horváth & Partners ist eine international tätige Unternehmensberatung. Die über 700 Mitarbeiter erzielten zuletzt 145 Mio. Euro Umsatz. Julia Kammler, die BWL studiert und ihren Bachelor und Master an der Uni Regensburg gemacht hat, ist seit einem Jahr dabei.
Wann merkten Sie, dass Beratung das Richtige für Sie ist?

Julia Kammler
Kammler: Während meines Auslandssemesters an der Audencia Business School in Nantes. Im Unterricht wurden viele Case Studies eingesetzt, die mich auf den Geschmack brachten.
Wie kamen Sie zu Horváth & Partners?
Kammler: Ich habe mich bei einigen Unternehmensberatungen umgesehen und auch beworben. Bei Horváth passte dann für mich alles zusammen: das Fachliche und die Unternehmenskultur.
Hatten Sie ein Praktikum bei einer Beratung gemacht?
Kammler: Nein, ich habe mich aber sehr genau über den Beruf und die Beratertätigkeit informiert ...
... und wahrscheinlich auch gut auf die Interviews bei der Bewerbung vorbereitet.
Kammler: Ja, das sollte man auch unbedingt tun. Insbesondere Case Studies lassen sich gut zur Vorbereitung auf die Gespräche üben.
Haben Sie da ein paar Tipps?
Kammler: Viele denken, es werde eine perfekte Lösung von einem erwartet. Die gibt es ohnehin meist nicht. Entscheidend ist vielmehr, dass man sich — ähnlich wie bei der täglichen Beratung — den Kernproblemen analytisch nähert. Vor allem sollte man die Interviewer an seinen Gedankengängen teilhaben lassen und nicht schweigend vor sich hinbrüten. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass man sich gedanklich verrennt.
In welchem Bereich arbeiten Sie bei Horváth und Partners?
Kammler: Im Branchenteam Industrial, Goods & High-Tech. Hier werden alle Kunden der produzierenden Industrie, ausgenommen Auto, Chemie, Öl und Pharma, betreut.
Womit befassen Sie sich derzeit?
Kammler: Aktuell beraten wir ein Unternehmen bei der Konzeption eines ganzheitlichen Steuerungskonzeptes und beim Management Reporting. Dabei wird deutlich, dass Controlling ein weites Feld ist, das von Vertriebs- über HR- bis zum Produktions-Controlling reicht, um nur einiges zu nennen.
Benötigt man einen Controlling-Schwerpunkt, um bei Ihnen einzusteigen?
Kammler: Nein. Neben Controlling-Themen befassen wir uns auch mit Strategy, Innovation, Sales sowie effizienten Prozessen und Organisationen. Dabei arbeiten wir eng mit den Experten aus unseren funktionalen Kompetenzfeldern zusammen. Durch diese Kombination von Themenspezialisten und Branchenexperten können wir den Kunden das bestmögliche Know-how bieten.
Was macht einen erfolgreichen Berater aus?
Kammler: Wichtig sind systematisches und analytisches Vorgehen, ein ordentlicher Schuss Kreativität und unternehmerisches Denken. Zudem sind besondere Soft Skills wie Teamgeist für die Projektarbeit, aber auch Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kunden gefragt.
Was gefällt Ihnen besonders gut bei Horváth & Partners?
Kammler: Es ist der Mix aus spannenden Projekten und einer positiven und professionellen Unternehmenskultur. Man ist fachlich gefordert — und es entstehen auch Freundschaften. Es macht also wirklich Spaß!
Das war nicht immer so. Als die Controlling-Welle Ende der siebziger Jahre von den USA nach Deutschland herüberschwappte, rümpften viele Firmenchefs und Manager die Nase. Controller — das roch nach Aufpasser und Besserwisser, nach einem Zahlenmensch, der ständig von Kosten und Effizienz redete und sich in die Angelegenheiten der Geschäftsführung einmischte, aber keinen Riecher fürs Geschäft und vor allem keine strategischen Visionen hatte.
Spätestens die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 hat die Skeptiker dann eines Besseren belehrt. Denn es waren vor allem Controller, die in der Krise einen kühlen Kopf bewahrten und das Unternehmen trotz heftiger Turbulenzen auf Kurs hielten. Dabei halfen ihnen ihr breites Wissen über die Stärken und Schwächen der Firma und ihr guter Draht zu Investoren und Kreditgebern, die sich von ihnen überzeugen ließen, an Bord zu bleiben.
Trotz dieser Erfolge haftet Controllern bis heute das Image des pingeligen Oberaufsehers an. Das liegt einerseits am Begriff: „to control“ bedeutet zwar auch „steuern“ und „regeln“, klingt aber vor allem nach Kontrolle — und ist damit eher negativ besetzt. Zum anderen waren Controller während der Rationalisierungswellen in den neunziger Jahren tatsächlich vor allem als Kostensenker und Umstrukturierer gefragt. Controlling war fortan zwar in aller Munde, und an den Hochschulen schossen Controlling-Lehrstühle wie Pilze aus dem Boden. Doch die Controller hatten ihren Ruf weg.
Diese einseitige Kostenfixierung hat das Controlling jedoch längst hinter sich gelassen. Moderne Controller begreifen sich heute vielmehr als Steuerleute des Unternehmens, die darauf achten, dass alle geschäftlichen Vorgänge zuverlässig gemessen und überprüft werden können. Vielfach wird auch nicht mehr von Controlling, sondern von Unternehmenssteuerung gesprochen. Für die Firmenchefs werden sie damit zu einer Art Business-Partner, mit denen man die Entwicklung des Unternehmens und neue Pläne diskutieren kann. Kennzahlen helfen ihnen, den Überblick zu behalten und auch die kompliziertesten Prozesse transparent zu machen.
Kommt es später zu Planabweichungen ergreifen sie Gegenmaßnahmen oder zeigen der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand, dem sie direkt zuarbeiten, Alternativen auf, mit denen sich die angestrebten Ziele doch noch erreichen lassen.
Information, Steuerung und Kontrolle sind allerdings nur drei — wenn auch äußerst wichtige — Aufgaben von Controllern. Fast ebenso bedeutend ist die Planung und Vorbereitung von Entscheidungen. So informiert der Controller den Vorstand über potenzielle Schwachstellen im Unternehmen und unterbreitet Vorschläge, wie bestimmte Prozesse verbessert und die Kosten gesenkt werden können. Das macht ihn auch bei anstehenden Akquisitionen und der Bewertung anderer Unternehmen zum wichtigen Ratgeber.
CTcon
Ärmelschoner waren gestern
CTcon ist eine Unternehmensberatung, die sich auf Unternehmenssteuerung spezialisiert hat. Zu den Kunden zählen viele DAX-Konzerne. Björn Radtke, Partner bei CTcon, erläutert, wie sich das Controlling im Lauf der Jahre verändert hat.
Controlling hat bis heute einen weiten Weg zurückgelegt.
Radtke: In der Tat hat es sich in den letzten zwanzig Jahren in der Unternehmenspraxis erheblich weiterentwickelt. Es geht inzwischen um die aktive Gestaltung der Unternehmenssteuerung und integriertes Performance Management.

Björn Radtke
Also weg von dem alten Bild des zahlenfixierten Kontrolleurs mit Ärmelschonern?
Radtke: So könnte man sagen, wobei Zahlen natürlich letztlich entscheidend sind, wenn man ein Unternehmen zum Erfolg führen will. Doch während der Controller früher oft klischeehaft als „Zahlenknecht“, „Erbsenzähler“ oder auch „risikoscheuer Spielverderber“ wahrgenommen wurde, nimmt er heute die Rolle eines Business-Partners ein, der aus unternehmerischer Sicht die Risiken und Chancen gleichermaßen im Auge behält.
Also so etwas wie ein Sparringspartner für den CEO?
Radtke: Ja, denn CEOs und ihre Manager wünschen sich jemanden, der verlässliche Fakten liefert und sie darüber hinaus bei den unternehmerischen Entscheidungen aktiv berät. Und jemanden, mit dem neue Entwicklungen und Pläne auf rationaler Faktenbasis intensiv diskutiert werden können.
Start-ups wie Snap, die noch keinen Cent verdienen, sondern nur Verluste machen, gehen an die Börse. Einige werden trotzdem erfolgreich. Erfordert das nicht ein neues Controllingdenken?
Radtke: Das sind neue Geschäftsmodelle, die andere Steuerungsansätze aus dem Controlling notwendig machen. Mit dem klassischen monatlichen Kostenreport kommt man hier nicht weit.
In letzter Zeit rücken immer mehr Controller in die Leitung großer Konzerne auf.
Radtke: Eine sehr interessante Entwicklung. Sie zeigt, dass Controller mit ausgeprägtem Geschäftsverständnis — also besagte Business-Partner — eine gute Basis haben, selbst ein Unternehmen zu leiten.
Auch eine interessante Entwicklung für Absolventen, die deutlich macht, dass man als Controller heute bis ganz nach oben kommen kann.
Radtke: Nicht nur das. Es zeigt auch, wie spannend Controlling inhaltlich ist, wird es als Unternehmenssteuerung verstanden. Zumal es oft um strategische Entscheidungen geht, die für die Unternehmen von erheblicher Bedeutung sind.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
Radtke: Sie ist ein Megatrend — auch im Controlling. Zum einen automatisiert sie Routinearbeiten, zum anderen ist sie ein Enabler, der die Steuerung erheblich verbessert.
Haben damit auch Wirtschaftsinformatiker und Informatiker bei Ihnen eine Chance?
Radtke: Absolut. Willkommen sind auch Ingenieure, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Generell gilt: Weniger Excel, mehr Verständnis für Algorithmen und Szenarioanalysen und tiefes Verständnis für das Business.
Müssen BWLer einen Controlling-Schwerpunkt haben?
Radtke: Er ist hilfreich, aber kein Muss. Voraussetzung ist definitiv das Interesse an unseren Kernthemen.
In vielen Firmen hat sich der Controller daher längst zum unverzichtbaren internen Berater entwickelt, der bei allen wichtigen Entscheidungen des Managements — wie der Erschließung neuer Geschäftsfelder, der unternehmensweiten Umstellung auf ein neues IT-System oder dem Verkauf eines Betriebsteils — hinzugezogen wird. Wenn er als Chief Financial Officer (CFO), dem auch meist das Controlling untersteht, nicht ohnehin mit am Tisch sitzt. In manchen Firmen gibt es auch einen Chief Controlling Officer (CCO).
Inwieweit seine Tätigkeit über das interne Rechnungswesen und Reporting hinausgeht und auch strategische Aufgaben umfasst, hängt von der Art, Größe und Struktur des jeweiligen Unternehmens ab. In vielen kleineren und mittelgroßen Unternehmen trifft man noch auf den traditionellen Controller-Typ, der seine Hauptaufgabe vor allem darin sieht, die betrieblichen Abläufe mittels Kennziffern aus der Finanzbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung zu planen, zu steuern und zu überwachen. Sein Platz ist nicht die Kommandobrücke, sondern der Maschinenraum des Unternehmens.
Der Controller der Zukunft hat dagegen das große Ganze im Blick. Er orientiert sich nicht nur an harten Fakten, sondern auch an weichen Merkmalen. Ein Grund ist, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise auch im Controlling zu einer neuen Denkhaltung geführt hat. Stichwort „nachhaltiges Controlling“: Danach soll Controlling nicht nur — wie bisher — die kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern auch die langfristige Steigerung des Unternehmenswertes im Auge haben. Wobei mit Unternehmenswert nicht nur der Börsenwert gemeint ist, sondern der Wert aus Sicht aller Stakeholder, also der Mitarbeiter, Kunden und sonstigen Betroffenen. Dieser nachhaltige Ansatz zeigt erneut, wie weit sich das moderne Controlling inzwischen von der reinen Kostenrechnerei entfernt hat.
Ein weiterer Trend im Controlling, der die Controller vor neue Herausforderungen stellt: das Zusammenwachsen von interner und externer Rechnungslegung. Das kommt daher, dass Unternehmen, die ihre Strategie am Shareholder Value ausrichten, starkes Interesse an größtmöglicher Transparenz haben. Denn welcher Anleger oder Analyst hat schon Zeit und Lust, sich mit zweierlei Arten von Daten rumzuschlagen? Das interne Rechnungswesen wird sich deshalb noch stärker externen Ansprüchen öffnen und vor allem die Anforderungen der Kapitalmärkte berücksichtigen müssen.
Die enorme Aufwertung des Controllings hat auch dazu geführt, dass Controller heute in fast allen Funktionsbereichen des Unternehmens eingesetzt werden. So gibt es nicht nur ein Produktions-, Marketing-, HR-, Finanz-, Risiko- und Personal-Controlling, sondern auch Controller, die Prozesse, Projekte und Investitionen planen und überwachen. Damit nicht genug: Ähnlich wie das Marketing hat sich das Controlling so weit ausdifferenziert, dass es ein eigenständiges Banken-, Handels-, Industrie- und Dienstleistungscontrolling gibt. Auch Medizincontroller sind nichts Ungewöhnliches mehr.
Bei all dem wundert es nicht, dass Controlling zu den beliebtesten Vertiefungsrichtungen der BWL gehört. Dabei dürften auch die guten Verdienstmöglichkeiten in diesem Beruf eine Rolle spielen: Laut der Jobbörse Absolventa kommen Controller auf durchschnittlich 55.000 Euro, wobei das tatsächliche Gehalt vom jeweiligen Berufsfeld abhängt.
Viele Hochschulen haben sich einen Controlling-Lehrstuhl zugelegt oder einfach ihre alten Rechnungswesen- und Revisionslehrstühle umbenannt. Auch ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen oder Finanzierung ist eine gute Vorbereitung, will man später im Controlling arbeiten. Wer erst nach dem Bachelor-Studium auf den Geschmack kommt und sich zum Controller aus- bzw. weiterbilden lassen möchte, kann ein entsprechendes Master-Studium beginnen oder sich bei einer privaten Ausbildungsstätte wie der Controller-Akademie (controllerakademie.de) in Seminaren das nötige Wissen zulegen.
Auch wenn weiche Faktoren im Controlling immer mehr an Bedeutung gewinnen: Für Zahlen sollte man sich schon begeistern können, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Neben guten Mathe- sind auch IT-Kenntnisse wichtig, um als Controller stets den Durchblick zu haben. Schließlich geht im Controlling nichts ohne die richtige Software.
Ebenfalls wichtig: gutes Kommunikationsvermögen. Denn Controller müssen laufend präsentieren, moderieren, Meetings leiten und sich dabei präzise und vor allem verständlich ausdrücken. Allein um ihre Erkenntnisse auch denjenigen klarzumachen, die nicht so sehr mit der Materie vertraut sind.